
Zertifizierte Fortbildung: COPD
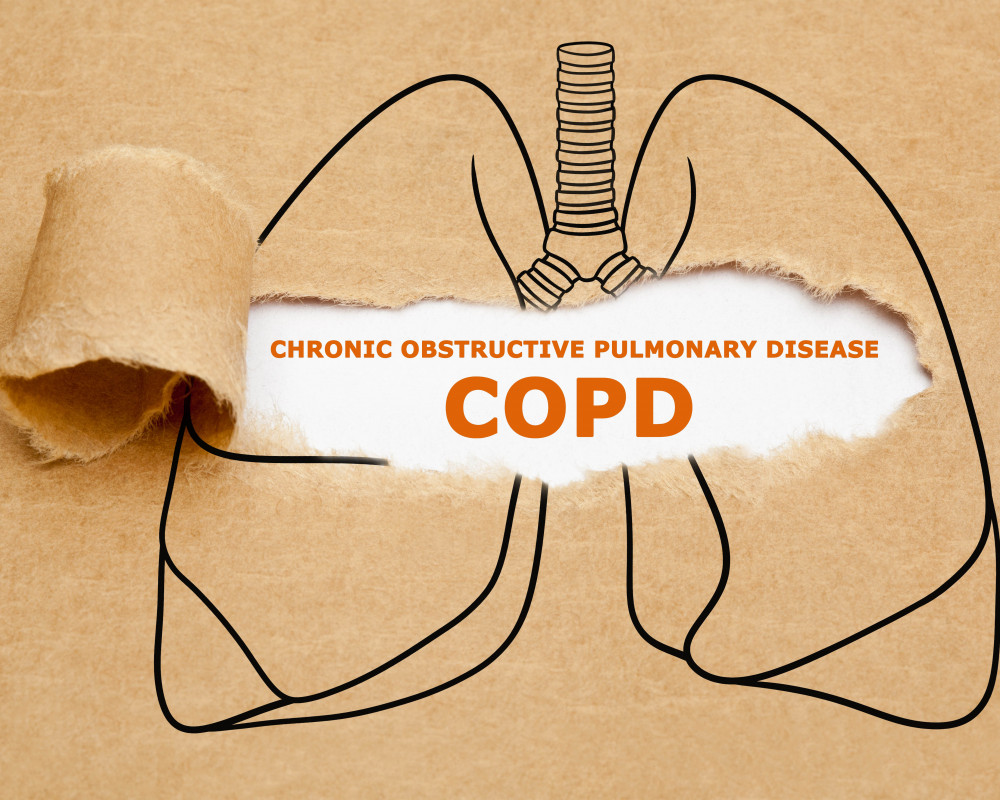
- Die COPD ist eine chronische und progredient verlaufende Lungenerkrankung mit den typischen Symptomen Atemnot, Husten und Auswurf.
- Sie wird häufig erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert.
- Zur Behandlung werden hauptsächlich Bronchodilatatoren (Beta-2-Sympathomimetika und Muscarinrezeptor-Antagonisten) inhalativ eingesetzt. Nur bei stark entzündlicher Erkrankung sowie nicht beherrschbaren Exazerbationen sind Glukokortikoide eine Option.
- Die wichtigste nicht medikamentöse Maßnahme ist der Rauchstopp. Auch angepasste körperliche Aktivität beeinflusst die Erkrankung positiv.
Login
Dieser Artikel ist nur für registrierte Nutzer sichtbar
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort ein oder registrieren Sie sich kostenlos.
Kommentar schreiben
Die Meinung und Diskussion unserer Nutzer ist ausdrücklich erwünscht. Bitte achten Sie im Sinne einer angenehmen Kommunikation auf unsere Netiquette. Vielen Dank!